Wie muss man sich die "Härteverteilung" bei selektiv gehärteten Klingen vorstellen?
Härteverteilung ist vielleicht das falsche Wort. Mich interessiert wie groß der Übergang zwischen hart und weich ist, bzw. wie abgegrenzt die beiden Bereiche sind. Ist also nur der Rücken weich und wird dann langsam härter bis zur Schneide oder gibt's einen plötzlichen Sprung (an der Härtelinie)?
Hat das hier schonmal jemand messtechnisch untersucht? Gibt's Erfahrungswerte? Kann man sowas überhaupt verallgemeinern oder gibt es große Unterschiede bedingt durch Stahltyp und/oder Härte-/Anlassverfahren?
Härteverteilung ist vielleicht das falsche Wort. Mich interessiert wie groß der Übergang zwischen hart und weich ist, bzw. wie abgegrenzt die beiden Bereiche sind. Ist also nur der Rücken weich und wird dann langsam härter bis zur Schneide oder gibt's einen plötzlichen Sprung (an der Härtelinie)?
Hat das hier schonmal jemand messtechnisch untersucht? Gibt's Erfahrungswerte? Kann man sowas überhaupt verallgemeinern oder gibt es große Unterschiede bedingt durch Stahltyp und/oder Härte-/Anlassverfahren?




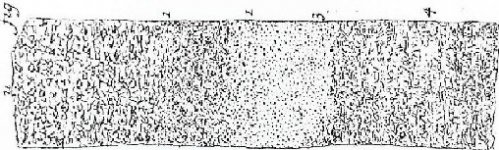
 (Epochen ?, Dynastien ?, Meistern ?, Regionen ?)
(Epochen ?, Dynastien ?, Meistern ?, Regionen ?)