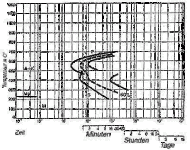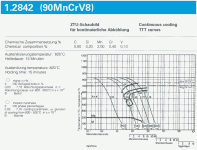mikromeister
Mitglied
- Beiträge
- 316
Wie hier oft beschrieben habe ich bei einer 300x30x5mm Klinge aus 2842 versucht die Härtetemperatur per Magnet zu bestimmen.
Mein Magnet hat ca. 25mm im Durchmesser.
Da ich in meiner Gasesse keine völlig gleichmäßige Glühfarbe hinbekommen habe, versuchte ich die kälteste Stelle über die Umwandlungstemperatur zu bekommen und habe dabei folgende seltsame Erfahrung gemacht:
Nicht die dunkelste Stelle war am längsten magnetisch sondern irgendeine mit mittlerer Glühfarbe. Besonders beim Abkühlen war eindeutig zu sehen, dass es kältere unmagnetische und wärmere magnetische Zonen gab!
Wie kann das sein?
Ich schätze die Temperaturdifferenzen innerhalb der Klinge waren kleiner 100°
Versuchsweise habe ich dann die Klingenspitze bei einer Temperatur wo sicher schon wieder alles magnetisch war in Wasser gesteckt und trotzdem ist sie tadellos hart geworden.
Ich glaube ich habe bei Tageslicht keine Glühfarbe mehr gesehen.
Mein Magnet hat ca. 25mm im Durchmesser.
Da ich in meiner Gasesse keine völlig gleichmäßige Glühfarbe hinbekommen habe, versuchte ich die kälteste Stelle über die Umwandlungstemperatur zu bekommen und habe dabei folgende seltsame Erfahrung gemacht:
Nicht die dunkelste Stelle war am längsten magnetisch sondern irgendeine mit mittlerer Glühfarbe. Besonders beim Abkühlen war eindeutig zu sehen, dass es kältere unmagnetische und wärmere magnetische Zonen gab!
Wie kann das sein?
Ich schätze die Temperaturdifferenzen innerhalb der Klinge waren kleiner 100°
Versuchsweise habe ich dann die Klingenspitze bei einer Temperatur wo sicher schon wieder alles magnetisch war in Wasser gesteckt und trotzdem ist sie tadellos hart geworden.
Ich glaube ich habe bei Tageslicht keine Glühfarbe mehr gesehen.