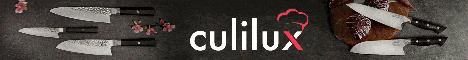AW: Elektronenmikroskopaufnahmen verschieden geschärfter Schneiden - bes. per Wetzsta
Hallo Ibu !
Zur Verdeutlichung und zur wenigstens teilweisen Beantwortung Deiner Fragen folgende Anmerkungen:
1. Spezielle Aufnahmen, die die Abnutzung feinster Schneiden im Gebrauch in Abhängigkeit von Karbid- und Matrixkorngröße zeigen, sind mir außer den angegebenen Literaturstellen nicht bekannt.
Meine Überlegungen dazu beruhten zunächst auf der Beobachtung- ich habe so ziemlich mit allen Stählen, die man für Schneidzwecke sinnvoller Weise einsetzen kann, Versuche gemacht. Da zeigten sich recht klare Gesetzmäßigkeiten, die dafür sprachen, daß die beste Stabilität feinster Schneiden nicht bei den an sich verschleißfestesten Stählen zu finden war, sondern tatsächlich bei den Stählen, die durch richtige Schmiede- und Härtebehandlung das feinkörnigste Gefüge aufwiesen.
Daraus habe ich die Theorie von der Divergenz der Mikro- und Makrostabilität abgeleitet- ohne sie durch wissenschaftliche Untersuchungen belegen zu können.
Zum Glück habe ich dann in Roman Landes einen Mitstreiter gefunden, der durch sein Ingenieurstudium Zugang zu dem modernen wissenschaftlichen Apparat hatte.
Das Ergebnis war zunächst sein Buch "Messerklingen und Stahl" und in der Folgezeit haben wir von- man kann sagen- sämtlichen aktuellen Messerstählen Proben machen lassen, die in der Ruhr-Universität in Bochum in weichgeglühtem und gehärtetem Zustand geschliffen,geätzt und bei 100 facher, 200- facher und 1000 facher Vergrößerung fotografiert wurden. Einige dieser Gefügebilder sind mal hier in den Seiten gezeigt worden. Bei den Aufnahmen 1: 1000 ist die Auswertung besonders einfach und einleuchtend. Was auf den Bildern 1 mm groß erscheint, misst in Wirklichkeit 1 my. Wenn man nun ein Blatt mit einer solchen Aufnahme knickt und einen Winkel von 20- 40 Grad in der Knicköffnung betrachtet, entspricht dies einer sehr scharfen Schneide mit unter 1my Schneidenspitze. An der Kante des Knicks kann man dann sehen, welche Karbid- und Matrixkörner auf der Schneidkante zu liegen kämen und wie die Karbide in der Matrix eingebettet wären.
Das ist mit Beiträgen von Roman und Herbert recht ausführlich diskutiert worden- ich habe Beton mit Kieseln als Beispiel genommen, der offensichtlich vernaschte Herbert aber Schokolade mit Nüsschen- und die Ergebnisse sind für mich logisch zwingend. Roman wollte dies in einem zweiten Buch auswerten, das scheint aber noch etwas zu dauern.
2. Hier habe ich mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt. Ich habe die Frage in einem anderen Beitrag aufgenommen, ob die Rauheit des Stahls für den Wetzerfolg bei Stählen ohne Zügen maßgeblich sei. Das habe ich verneint.
3. Zwischen einem feinen Stahl und einem Leder mit Schleifpaste liegen, was die Feinheit der Einwirkung betrifft Welten
4. Wenn ich von Gebrauchsschärfe gesprochen habe, so meinte ich die gegenüber dem Abzug mit Leder deutlich verminderte Schärfe durch den Gebrauch, die aber durch die kurze Behandlung durch den Stahl in einem Bereich guter Nutzbarkeit gehalten werden kann.
5. Eine offene Schneide wirkt bissiger, als eine geschlossene. Für bestimmte Schneidgüter kann sie vorteilhaft sein. Bei gleicher Schärfe ist sie bei weitem weniger stabil, als eine geschlossene Schneide-wohlgemerkt im Bereich feiner und feinster Schneiden.
6. Deine Schlußfolgerung-grundsätzlich richtig. Warum muß man das aber so hart aussprechen ?. Auch andere Wege können zum Ziel führen und es gibt sicher die eine oder andere Nische, wo andere Schärfmethoden zu Recht überleben können.
Dazu noch der ein oder andere Gedanke:
Es ist nicht immer richtig, daß die genaue und geometrisch exakte Schneide den Zweck am besten erfüllt. Jean José Tritz hat mit dem Schneiden im Küchenbereich viel Erfahrung. Er hat festgestellt, daß eine absolut plan geschliffene Klinge mit exakt definiertem Schneidenwinkel bei feuchtem Schnittgut wesentlich schlechter abschneidet, als eine leicht ballige Schneide. Das liegt sicher daran, daß sich an der absolut planen Klinge das Schnittgut sozusagen ansaugt.
Eine leicht ballige Schneidenspitze wird sich weniger leicht umlegen oder bei extrem harten Klingen weniger leicht Ausbrüche zeigen.
Man kann es damit aber auch übertreiben: Ungeschicktes Hantieren mit dem Lederriemen mit Schleifpaste kann eine Schneide auch recht schnell abstumpfen. Der Grund ist einfach: Das Leder ist weich und die Schneide drückt sich etwas in das Leder hinein. Dadurch kann es zu einer Verrundung der Schneidkante und einem deutlichen Abfall der Schärfe kommen.
Ich arbeite beim Schärfen oft mit einem großen Naturschleifstein aus einem Schreinerbetrieb, der langsam und in Wasser läuft. Körnung wird etwa 500 entsprechen. Bei wirklich harten Stählen mit Sonderkarbiden greift der Stein schon recht langsam. Den entstandenen Grat-und hier meine ich einen hin und her wackelnden Faden oder wie man immer das nennen will- ziehe ich mal mit einem feinen Stein per Hand ab oder aber auch auf einem Schleifrad mit Schaumgummipolster, auf das ich Nassschleifpapier passender Körnung klebe und mit Wasser benutze. Dann ein paar wenige kontrollierte Züge über die verschiedenenen Leder und ich kann die drei Prüfungen: Fallendes Blatt, stehendes Blatt, frei gehaltenes Haar problemlos machen. Das geht natürlich auch mit anderen Methoden, aber eben auch so.
MfG U. Gerfin
Hallo Ibu !
Zur Verdeutlichung und zur wenigstens teilweisen Beantwortung Deiner Fragen folgende Anmerkungen:
1. Spezielle Aufnahmen, die die Abnutzung feinster Schneiden im Gebrauch in Abhängigkeit von Karbid- und Matrixkorngröße zeigen, sind mir außer den angegebenen Literaturstellen nicht bekannt.
Meine Überlegungen dazu beruhten zunächst auf der Beobachtung- ich habe so ziemlich mit allen Stählen, die man für Schneidzwecke sinnvoller Weise einsetzen kann, Versuche gemacht. Da zeigten sich recht klare Gesetzmäßigkeiten, die dafür sprachen, daß die beste Stabilität feinster Schneiden nicht bei den an sich verschleißfestesten Stählen zu finden war, sondern tatsächlich bei den Stählen, die durch richtige Schmiede- und Härtebehandlung das feinkörnigste Gefüge aufwiesen.
Daraus habe ich die Theorie von der Divergenz der Mikro- und Makrostabilität abgeleitet- ohne sie durch wissenschaftliche Untersuchungen belegen zu können.
Zum Glück habe ich dann in Roman Landes einen Mitstreiter gefunden, der durch sein Ingenieurstudium Zugang zu dem modernen wissenschaftlichen Apparat hatte.
Das Ergebnis war zunächst sein Buch "Messerklingen und Stahl" und in der Folgezeit haben wir von- man kann sagen- sämtlichen aktuellen Messerstählen Proben machen lassen, die in der Ruhr-Universität in Bochum in weichgeglühtem und gehärtetem Zustand geschliffen,geätzt und bei 100 facher, 200- facher und 1000 facher Vergrößerung fotografiert wurden. Einige dieser Gefügebilder sind mal hier in den Seiten gezeigt worden. Bei den Aufnahmen 1: 1000 ist die Auswertung besonders einfach und einleuchtend. Was auf den Bildern 1 mm groß erscheint, misst in Wirklichkeit 1 my. Wenn man nun ein Blatt mit einer solchen Aufnahme knickt und einen Winkel von 20- 40 Grad in der Knicköffnung betrachtet, entspricht dies einer sehr scharfen Schneide mit unter 1my Schneidenspitze. An der Kante des Knicks kann man dann sehen, welche Karbid- und Matrixkörner auf der Schneidkante zu liegen kämen und wie die Karbide in der Matrix eingebettet wären.
Das ist mit Beiträgen von Roman und Herbert recht ausführlich diskutiert worden- ich habe Beton mit Kieseln als Beispiel genommen, der offensichtlich vernaschte Herbert aber Schokolade mit Nüsschen- und die Ergebnisse sind für mich logisch zwingend. Roman wollte dies in einem zweiten Buch auswerten, das scheint aber noch etwas zu dauern.
2. Hier habe ich mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt. Ich habe die Frage in einem anderen Beitrag aufgenommen, ob die Rauheit des Stahls für den Wetzerfolg bei Stählen ohne Zügen maßgeblich sei. Das habe ich verneint.
3. Zwischen einem feinen Stahl und einem Leder mit Schleifpaste liegen, was die Feinheit der Einwirkung betrifft Welten
4. Wenn ich von Gebrauchsschärfe gesprochen habe, so meinte ich die gegenüber dem Abzug mit Leder deutlich verminderte Schärfe durch den Gebrauch, die aber durch die kurze Behandlung durch den Stahl in einem Bereich guter Nutzbarkeit gehalten werden kann.
5. Eine offene Schneide wirkt bissiger, als eine geschlossene. Für bestimmte Schneidgüter kann sie vorteilhaft sein. Bei gleicher Schärfe ist sie bei weitem weniger stabil, als eine geschlossene Schneide-wohlgemerkt im Bereich feiner und feinster Schneiden.
6. Deine Schlußfolgerung-grundsätzlich richtig. Warum muß man das aber so hart aussprechen ?. Auch andere Wege können zum Ziel führen und es gibt sicher die eine oder andere Nische, wo andere Schärfmethoden zu Recht überleben können.
Dazu noch der ein oder andere Gedanke:
Es ist nicht immer richtig, daß die genaue und geometrisch exakte Schneide den Zweck am besten erfüllt. Jean José Tritz hat mit dem Schneiden im Küchenbereich viel Erfahrung. Er hat festgestellt, daß eine absolut plan geschliffene Klinge mit exakt definiertem Schneidenwinkel bei feuchtem Schnittgut wesentlich schlechter abschneidet, als eine leicht ballige Schneide. Das liegt sicher daran, daß sich an der absolut planen Klinge das Schnittgut sozusagen ansaugt.
Eine leicht ballige Schneidenspitze wird sich weniger leicht umlegen oder bei extrem harten Klingen weniger leicht Ausbrüche zeigen.
Man kann es damit aber auch übertreiben: Ungeschicktes Hantieren mit dem Lederriemen mit Schleifpaste kann eine Schneide auch recht schnell abstumpfen. Der Grund ist einfach: Das Leder ist weich und die Schneide drückt sich etwas in das Leder hinein. Dadurch kann es zu einer Verrundung der Schneidkante und einem deutlichen Abfall der Schärfe kommen.
Ich arbeite beim Schärfen oft mit einem großen Naturschleifstein aus einem Schreinerbetrieb, der langsam und in Wasser läuft. Körnung wird etwa 500 entsprechen. Bei wirklich harten Stählen mit Sonderkarbiden greift der Stein schon recht langsam. Den entstandenen Grat-und hier meine ich einen hin und her wackelnden Faden oder wie man immer das nennen will- ziehe ich mal mit einem feinen Stein per Hand ab oder aber auch auf einem Schleifrad mit Schaumgummipolster, auf das ich Nassschleifpapier passender Körnung klebe und mit Wasser benutze. Dann ein paar wenige kontrollierte Züge über die verschiedenenen Leder und ich kann die drei Prüfungen: Fallendes Blatt, stehendes Blatt, frei gehaltenes Haar problemlos machen. Das geht natürlich auch mit anderen Methoden, aber eben auch so.
MfG U. Gerfin