Hallo zusammen,
ich verfolge laufend die interessanten Beiträge zur Wärmebehandlung - besonders die Lehmmantel- und Wasser/Öl-Diskussionen.
Regelmäßigt taucht dabei die Frage nach Öl oder Wasser als Abschreckmittel auf und jedesmal wird vernünftigerweise zur Ölabschreckung (und zur Suchfunktion ) geraten.
) geraten.
Dennoch gibt es dann diese unverbesserlichen Anfänger-Kandidaten , die wie nach verbotenen Früchten lechtzend, mit der Wasserhärtung liebäugeln.
, die wie nach verbotenen Früchten lechtzend, mit der Wasserhärtung liebäugeln.
Eins vorweg: zu diesen Typen zähle ich mich auch!
Aus diesem Grunde möchte ich einfach mal zur Unterhaltung erzählen, wie es mir ergangen ist - vielleicht erkennt sich der eine oder andere darin wieder und auch die Profis verstehen vielleicht, dass nicht jeder Hydrophilist unter blinder "Beratungsresistenz" leidet.
Sollte ich hier etwas beschreiben, was völliger Blödsinn ist oder nur durch reinen Zufall geklappt hat, dann bitte sofort kommentieren (hilft mir und den anderen Anfängern)!!!
Und - das was ich hier schreibe ist nur meine persönliche Erfahrung aus wenigen Versuchen - richtiges Fachwissen findet Ihr in den entsprechenden Beiträge der Profis!
Und noch etwas wichtiges - MEIN ZIEL war und ist die differentielle Härtung von einfachen C-Stahl-Klingen mit Tanto-Form, also keine dünnen metallurgisch perfekt behandelten Klingen aus speziellen Stählen. Nur unter diesem Gesichtspunkt ist das nachfolgende zu verstehen.
Zur Sache:
Als Anfänger kennt man erst mal nur Wasser als Abschreckmittel (vielleicht noch Schnee oder Drachenblut aus komischen Filmen). Ist ja auch billig, überall zu bekommen und saut nicht rum.
Dann gibt's die Stähle, die als "Wasserhärter" bezeichnet werden - augenscheinlich passt das also!
Schließlich hat man noch Literatur und Dokumentationen über japanische Schwerter, in denen von Abschreck-Wasser mit bestimmten Temperaturen ("wie im August" oder "erwärmt durch die Pipi dreier Schneeaffen" etc.) geredet wird.
Hoch motiviert geht's also los:
1) Material
Mein Stahl ist CK75, da Stahl mit 0,7% Kohlenstoff der "optimale" Schwertstahl ist - zumindest suggerieren mir das meine Quellen.
Dass Tamahagane ein klein wenig anders als CK75 ist, ignoriere ich jetzt einfach mal (mir bleibt ja auch nichts anderes übrig...).
2) Rohling
CK75 geschnappt und alles weggeflext, was nicht nach Tanto aussieht.
Schneide erstmal etwas breiter gelassen (0.5mm - 1mm). Das funktioniert soweit!
Falten und Schmieden fallen weg: Ersten kann ich gar nicht schmieden und zweitens lassen dies meine Räumlichkeiten und mein Werkzeug nicht zu.
Und dann finde ich, dass gefaltete Stähle (Damaszenerstahl wie bei China-Repliken) zu auffällig für "japanische Schwerter" sind. Die Hada beim traditionellen Nihonto springt einem ja auch nicht von weitem ins Gesicht, sondern ist in der Regel äußerst fein und besteht auch nicht aus (optisch) verschiedenen Stahlsorten.
3) Lehm
Ok - da beginnen die Probleme: Was für einen Lehm nehme ich für die Isolierung? Die Quellen sprechen von Lehm/Steinpulver/Holzkohle-Gemisch...
Hier kann man viel experimentieren - ich verwende einfachen Schamottemörtel für Ofenbau vom Obi und mische evtl. noch etwas Lehmpulver etc. dazu. Der Schamottemörtel alleine tut's aber für meine Sache auch - ist nur nicht so "spannend". Die Töpfe mit "China-Clay", Quarzmehl und Holzkohlepulver stehen aber bereit!
4) Lehm auftragen
Schwer zu beschreiben - einfach probieren. Wichtig ist nur, dass die Klinge absolut fettfrei und leicht rauh ist, damit die Pampe hält. Nach dem Trocknen über Nacht (egal, ob Vollmond oder nicht) fixiere ich den Lehmmantel noch mit etwas Draht...
Mein Tipp: Den Lehm nicht zu dick aufzutragen - dünner (ca 3mm) reicht.
Bis jetzt ist noch nichts verpfuscht; das Spannende kommt erst noch!
5) Auf Härtetemperatur bringen
Hier geht's wieder los: Was ist die richtige Härtetemperatur für meinen Stahl?
Im Forum und in den Datenblätter der Hersteller findet man die nötigen Infos - aber wie zur Hölle misst man die Temperatur? Visuelle Beschreibungen wie "Abendmondröte" oder - wenn ich bei den Schneeaffen bleiben darf - "Farbe eines Schneeaffengesichts nach 23 Dörrpflaumen" sind wenig hilfreich! Wenn man kein robustes Fiebertermometer oder einen regelbaren Härteofen hat, ist die obige Frage sowieso hinfällig. Es hilft dann nur der Magnettest: Magnet an die glühende Schneide halten - wenn der Stahl nicht mehr magnetisch ist (Magie, Magie!), dann ist der Braten durch!
Übrigens: Ich härte in einem simplen selbstgebastelten Ytong Gasofen...
6) Abschrecken
Jetzt kommt's!
Mein erster Versuch: CK75-Klinge mit Lehmmantel an den Seiten und am Rücken.
Als ich die Härtetemperatur erreicht hatte, ab ins kalte Wasser!
Jeder Profi der das liest, bekommt jetzt das Mitleid-Schmunzel-Zucken in den Mundwinkeln: Es kommt natürlich zum unvermeidlichen Pling-Pling-Pling-Geräusch!
Für alle Laien: "Pling-Pling-Pling" bedeutet nichts anderes als "Knick-Knack-Kaputt!"
Neben sieben Rissen in der Schneide ist dennoch eine schöne Biegung und eine tolle Härteline entstanden - der Ansatz stimmt also, aber die Klinge ist futsch!
Was hatte ich falsch gemacht?
Definitiv ist kaltes Wasser ein Killer! :teuflisch
Dann - meine Interpretation - war der Lehmmantel ungünstig: Die gehärtete Schneide besteht aus Martensit, welches ein größeres Volumen als der ungehärtete Rest hat. Das führt zur charakteristischen Krümmung und in der Schneide normalerweise zu Druckspannungen. Da bei mir der gehärtete Bereich aber relativ breit war, vermute ich, dass die 'äußerste' bereits harte Schneidenkante beim Biegen gestreckt wurde. Bei einer glasharten Schneide kommt es halt dann zu Rissen. Ob das so stimmt - keine Ahnung...vielleicht war auch nur das kalte Wasser schuld!
Also neuer Versuch auf Nummer Sicher(er): warmes/heißes Wasser und lehmfreier Rücken:
Die Abschreckwirkung ist dann nicht ganz so schroff und der leicht angehärtete Rücken verhinderte eine stärkere Biegung. Das Ergebnis war ok -> Härteline ohne Risse!
Ich habe diese Prozedur mit der selben Klinge ohne Probleme mehmals durchgeführt, da mir das Hamon bei den ersten Malen nicht gefallen hat.
7) Anlassen
Anschließend noch ab neben die Pizza in den Ofen!
Ok, jetzt nehme ich für meinen nächsten Tanto C105!
Aber halt - jetzt rät mir jeder, nur Öl zu verwenden!
Also probiere ich es auch mit Öl - man ist ja gelehrig.
Blechrohr als Behälter und Speiseöl besorgt -> es ist eine Sauerei: Alles stinkt nach explodierter Pommes-Bude, flammt und ölt rum!
Aber die Klinge hält und nach mehreren Versuchen klappt auch das Handling einigermaßen.
Nur leider ist es mir nicht gelungen, mit Öl eine kontrollierte Härtelinie zu bekommen: Linie ja, aber nicht so wie ich wollte!
Wie ich dann über die Foren herausgefunden habe, ist dies mit Öl auch gar nicht möglich!
Ok - dann nehme ich Wasser & Öl: Wenige Sekunden in Wasser abschrecken und dann in Öl runterkühlen!
Olfaktorisch ist das um viele Klassen besser - der Duft nach frischen Pfannkuchen durchströmt die Räumlichkeiten.
Die Klinge hat es auch überlebt, aber die Härtelinie beim C105 ist immer noch nicht so wie gewünscht (auch nicht beim parallel gehärteten CK75).
Aber Achtung: Beim CK75 hat sich die Klinge stark zur Schneide hin gebogen - der vorher leicht gebogene Rohling war nach dem Härten gerade!
Wie dass nun metallurgisch zu erklären ist - keine blassen Schimmer!
Aber weiter im Text...
Verdammt - Wasser hat schon seinen Reiz!
Um Tränen zu vermeiden werde ich den restlichen C105 wohl dennoch in Öl (evtl. Wasser/Öl) härten und eine gerade Härteline hinnehmen ("Suguha ist cooles Understatement"). Eventuell kann ich mich bei der Wasser/Öl-Methode durch etwas längenen Wasseraufenthalt an ein gewünschtes Hamon rantasten...
Beim CK75 werde ich aber sicher auf Wasser zurückgreifen und hoffe auf tolle Ergebnisse!
MEIN Fazit:
Es gibt für jeden Stahl ein geeignetes Abschreckmedium, aber die Stahlsorte ist bei der Wahl des Mediums nicht das einzige Kriterium. Es kommt auch darauf an, WAS ich machen möchte. Und da besteht - nach meiner beschränkten Erfahrung - ein Unterschied, ob ich eine Klinge mit Hamon oder ein materialtechnisch perfekt gehärtetes Messer erzeugen will.
Die optimale Mischung aus beiden wäre natürlich die Königsklasse, aber noch ist man Anfänger und lernt durch Fehler...
Und wenn man der Typ für sowas ist, kommt es auch darauf an, WIE ich etwas mache, weil gerade das MACHEN das entscheidende (und das, was Spaß macht) ist. Und dann spielt sogar die Hintergrundmusik beim Lehmmischen eine wichtige Rolle.
Klar ist aber: Falls Ihr nichts mit dem Hamon-Ding oder ähnlichem am Hut habt und Ihr einfach schöne Messer machen wollt, dann härtet im mildesten Medium für Euren Stahl und das ist meistens Öl!
Noch was zur Illustration:
Fehlversuch CK75 + kaltes Wasser (Rohling war vorher gerade):

Versuch mit heißem Wasser (und ohne Rückenisolation):

Nächster Versuch mit heißem Wasser (dieselbe Klinge wie oben):

ich verfolge laufend die interessanten Beiträge zur Wärmebehandlung - besonders die Lehmmantel- und Wasser/Öl-Diskussionen.
Regelmäßigt taucht dabei die Frage nach Öl oder Wasser als Abschreckmittel auf und jedesmal wird vernünftigerweise zur Ölabschreckung (und zur Suchfunktion
Dennoch gibt es dann diese unverbesserlichen Anfänger-Kandidaten
 , die wie nach verbotenen Früchten lechtzend, mit der Wasserhärtung liebäugeln.
, die wie nach verbotenen Früchten lechtzend, mit der Wasserhärtung liebäugeln.Eins vorweg: zu diesen Typen zähle ich mich auch!
Aus diesem Grunde möchte ich einfach mal zur Unterhaltung erzählen, wie es mir ergangen ist - vielleicht erkennt sich der eine oder andere darin wieder und auch die Profis verstehen vielleicht, dass nicht jeder Hydrophilist unter blinder "Beratungsresistenz" leidet.
Sollte ich hier etwas beschreiben, was völliger Blödsinn ist oder nur durch reinen Zufall geklappt hat, dann bitte sofort kommentieren (hilft mir und den anderen Anfängern)!!!
Und - das was ich hier schreibe ist nur meine persönliche Erfahrung aus wenigen Versuchen - richtiges Fachwissen findet Ihr in den entsprechenden Beiträge der Profis!
Und noch etwas wichtiges - MEIN ZIEL war und ist die differentielle Härtung von einfachen C-Stahl-Klingen mit Tanto-Form, also keine dünnen metallurgisch perfekt behandelten Klingen aus speziellen Stählen. Nur unter diesem Gesichtspunkt ist das nachfolgende zu verstehen.
Zur Sache:
Als Anfänger kennt man erst mal nur Wasser als Abschreckmittel (vielleicht noch Schnee oder Drachenblut aus komischen Filmen). Ist ja auch billig, überall zu bekommen und saut nicht rum.
Dann gibt's die Stähle, die als "Wasserhärter" bezeichnet werden - augenscheinlich passt das also!
Schließlich hat man noch Literatur und Dokumentationen über japanische Schwerter, in denen von Abschreck-Wasser mit bestimmten Temperaturen ("wie im August" oder "erwärmt durch die Pipi dreier Schneeaffen" etc.) geredet wird.
Hoch motiviert geht's also los:
1) Material
Mein Stahl ist CK75, da Stahl mit 0,7% Kohlenstoff der "optimale" Schwertstahl ist - zumindest suggerieren mir das meine Quellen.
Dass Tamahagane ein klein wenig anders als CK75 ist, ignoriere ich jetzt einfach mal (mir bleibt ja auch nichts anderes übrig...).
2) Rohling
CK75 geschnappt und alles weggeflext, was nicht nach Tanto aussieht.
Schneide erstmal etwas breiter gelassen (0.5mm - 1mm). Das funktioniert soweit!
Falten und Schmieden fallen weg: Ersten kann ich gar nicht schmieden und zweitens lassen dies meine Räumlichkeiten und mein Werkzeug nicht zu.
Und dann finde ich, dass gefaltete Stähle (Damaszenerstahl wie bei China-Repliken) zu auffällig für "japanische Schwerter" sind. Die Hada beim traditionellen Nihonto springt einem ja auch nicht von weitem ins Gesicht, sondern ist in der Regel äußerst fein und besteht auch nicht aus (optisch) verschiedenen Stahlsorten.
3) Lehm
Ok - da beginnen die Probleme: Was für einen Lehm nehme ich für die Isolierung? Die Quellen sprechen von Lehm/Steinpulver/Holzkohle-Gemisch...
Hier kann man viel experimentieren - ich verwende einfachen Schamottemörtel für Ofenbau vom Obi und mische evtl. noch etwas Lehmpulver etc. dazu. Der Schamottemörtel alleine tut's aber für meine Sache auch - ist nur nicht so "spannend". Die Töpfe mit "China-Clay", Quarzmehl und Holzkohlepulver stehen aber bereit!
4) Lehm auftragen
Schwer zu beschreiben - einfach probieren. Wichtig ist nur, dass die Klinge absolut fettfrei und leicht rauh ist, damit die Pampe hält. Nach dem Trocknen über Nacht (egal, ob Vollmond oder nicht) fixiere ich den Lehmmantel noch mit etwas Draht...
Mein Tipp: Den Lehm nicht zu dick aufzutragen - dünner (ca 3mm) reicht.
Bis jetzt ist noch nichts verpfuscht; das Spannende kommt erst noch!
5) Auf Härtetemperatur bringen
Hier geht's wieder los: Was ist die richtige Härtetemperatur für meinen Stahl?
Im Forum und in den Datenblätter der Hersteller findet man die nötigen Infos - aber wie zur Hölle misst man die Temperatur? Visuelle Beschreibungen wie "Abendmondröte" oder - wenn ich bei den Schneeaffen bleiben darf - "Farbe eines Schneeaffengesichts nach 23 Dörrpflaumen" sind wenig hilfreich! Wenn man kein robustes Fiebertermometer oder einen regelbaren Härteofen hat, ist die obige Frage sowieso hinfällig. Es hilft dann nur der Magnettest: Magnet an die glühende Schneide halten - wenn der Stahl nicht mehr magnetisch ist (Magie, Magie!), dann ist der Braten durch!
Übrigens: Ich härte in einem simplen selbstgebastelten Ytong Gasofen...
6) Abschrecken
Jetzt kommt's!
Mein erster Versuch: CK75-Klinge mit Lehmmantel an den Seiten und am Rücken.
Als ich die Härtetemperatur erreicht hatte, ab ins kalte Wasser!

Jeder Profi der das liest, bekommt jetzt das Mitleid-Schmunzel-Zucken in den Mundwinkeln: Es kommt natürlich zum unvermeidlichen Pling-Pling-Pling-Geräusch!
Für alle Laien: "Pling-Pling-Pling" bedeutet nichts anderes als "Knick-Knack-Kaputt!"
Neben sieben Rissen in der Schneide ist dennoch eine schöne Biegung und eine tolle Härteline entstanden - der Ansatz stimmt also, aber die Klinge ist futsch!
Was hatte ich falsch gemacht?
Definitiv ist kaltes Wasser ein Killer! :teuflisch
Dann - meine Interpretation - war der Lehmmantel ungünstig: Die gehärtete Schneide besteht aus Martensit, welches ein größeres Volumen als der ungehärtete Rest hat. Das führt zur charakteristischen Krümmung und in der Schneide normalerweise zu Druckspannungen. Da bei mir der gehärtete Bereich aber relativ breit war, vermute ich, dass die 'äußerste' bereits harte Schneidenkante beim Biegen gestreckt wurde. Bei einer glasharten Schneide kommt es halt dann zu Rissen. Ob das so stimmt - keine Ahnung...vielleicht war auch nur das kalte Wasser schuld!
Also neuer Versuch auf Nummer Sicher(er): warmes/heißes Wasser und lehmfreier Rücken:
Die Abschreckwirkung ist dann nicht ganz so schroff und der leicht angehärtete Rücken verhinderte eine stärkere Biegung. Das Ergebnis war ok -> Härteline ohne Risse!
Ich habe diese Prozedur mit der selben Klinge ohne Probleme mehmals durchgeführt, da mir das Hamon bei den ersten Malen nicht gefallen hat.
7) Anlassen
Anschließend noch ab neben die Pizza in den Ofen!
Ok, jetzt nehme ich für meinen nächsten Tanto C105!
Aber halt - jetzt rät mir jeder, nur Öl zu verwenden!
Also probiere ich es auch mit Öl - man ist ja gelehrig.
Blechrohr als Behälter und Speiseöl besorgt -> es ist eine Sauerei: Alles stinkt nach explodierter Pommes-Bude, flammt und ölt rum!

Aber die Klinge hält und nach mehreren Versuchen klappt auch das Handling einigermaßen.
Nur leider ist es mir nicht gelungen, mit Öl eine kontrollierte Härtelinie zu bekommen: Linie ja, aber nicht so wie ich wollte!
Wie ich dann über die Foren herausgefunden habe, ist dies mit Öl auch gar nicht möglich!
Ok - dann nehme ich Wasser & Öl: Wenige Sekunden in Wasser abschrecken und dann in Öl runterkühlen!
Olfaktorisch ist das um viele Klassen besser - der Duft nach frischen Pfannkuchen durchströmt die Räumlichkeiten.
Die Klinge hat es auch überlebt, aber die Härtelinie beim C105 ist immer noch nicht so wie gewünscht (auch nicht beim parallel gehärteten CK75).
Aber Achtung: Beim CK75 hat sich die Klinge stark zur Schneide hin gebogen - der vorher leicht gebogene Rohling war nach dem Härten gerade!
Wie dass nun metallurgisch zu erklären ist - keine blassen Schimmer!

Aber weiter im Text...
Verdammt - Wasser hat schon seinen Reiz!
Um Tränen zu vermeiden werde ich den restlichen C105 wohl dennoch in Öl (evtl. Wasser/Öl) härten und eine gerade Härteline hinnehmen ("Suguha ist cooles Understatement"). Eventuell kann ich mich bei der Wasser/Öl-Methode durch etwas längenen Wasseraufenthalt an ein gewünschtes Hamon rantasten...
Beim CK75 werde ich aber sicher auf Wasser zurückgreifen und hoffe auf tolle Ergebnisse!
MEIN Fazit:
Es gibt für jeden Stahl ein geeignetes Abschreckmedium, aber die Stahlsorte ist bei der Wahl des Mediums nicht das einzige Kriterium. Es kommt auch darauf an, WAS ich machen möchte. Und da besteht - nach meiner beschränkten Erfahrung - ein Unterschied, ob ich eine Klinge mit Hamon oder ein materialtechnisch perfekt gehärtetes Messer erzeugen will.
Die optimale Mischung aus beiden wäre natürlich die Königsklasse, aber noch ist man Anfänger und lernt durch Fehler...
Und wenn man der Typ für sowas ist, kommt es auch darauf an, WIE ich etwas mache, weil gerade das MACHEN das entscheidende (und das, was Spaß macht) ist. Und dann spielt sogar die Hintergrundmusik beim Lehmmischen eine wichtige Rolle.
Klar ist aber: Falls Ihr nichts mit dem Hamon-Ding oder ähnlichem am Hut habt und Ihr einfach schöne Messer machen wollt, dann härtet im mildesten Medium für Euren Stahl und das ist meistens Öl!
Noch was zur Illustration:
Fehlversuch CK75 + kaltes Wasser (Rohling war vorher gerade):

Versuch mit heißem Wasser (und ohne Rückenisolation):

Nächster Versuch mit heißem Wasser (dieselbe Klinge wie oben):


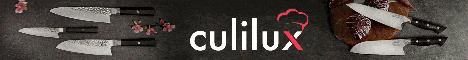





 Jetzt bin ich nur etwas unsicher ob die Härtung gleichmäßig verlaufen ist, da auf einer Seite ein Fleck ist, der von der Ätzung her fast so aussieht wie der Bereich, auf dem der Mantel war. Was könnte das sein?
Jetzt bin ich nur etwas unsicher ob die Härtung gleichmäßig verlaufen ist, da auf einer Seite ein Fleck ist, der von der Ätzung her fast so aussieht wie der Bereich, auf dem der Mantel war. Was könnte das sein? 