Hallo Leute,
ich muß zugeben, ich bin jetzt etwas verunsichert!
Anbei ein Diagramm in dem C45 gehärtet, vergütet und normalisiert aufgeführt ist.
So wie ich das im Moment sehe, kann ich den gehärteten Stahl einer höheren Spannung (zumindest hier Zugspannung) aussetzen als einen normalisierten, ohne das es zu einem Bauteilversagen kommt.
Das sieht für mich soweit ganz logisch aus.
Möglicherweise ist die Bezeichnung Biegesteifigkeit wirklich nicht glücklich gewählt.
In erster Linie geht es mir um eine festere Klinge, dabei wird natürlich auch gebogen.
Vieleicht könnte man ja erst eine Klärung schaffen ob meine obige Sicht (Erhöhte Zugspannung wird möglich durch Härtung/ Vergütung) so stimmt.

Grüße aus Heidelberg!
less
ich muß zugeben, ich bin jetzt etwas verunsichert!
Anbei ein Diagramm in dem C45 gehärtet, vergütet und normalisiert aufgeführt ist.
So wie ich das im Moment sehe, kann ich den gehärteten Stahl einer höheren Spannung (zumindest hier Zugspannung) aussetzen als einen normalisierten, ohne das es zu einem Bauteilversagen kommt.
Das sieht für mich soweit ganz logisch aus.
Möglicherweise ist die Bezeichnung Biegesteifigkeit wirklich nicht glücklich gewählt.
In erster Linie geht es mir um eine festere Klinge, dabei wird natürlich auch gebogen.
Vieleicht könnte man ja erst eine Klärung schaffen ob meine obige Sicht (Erhöhte Zugspannung wird möglich durch Härtung/ Vergütung) so stimmt.

Grüße aus Heidelberg!
less

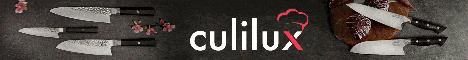

 .
. )
) . Mit dem E-Modul lassen sich bei bekannter Belastung umgekehrt Dehnungen berechnen, z.B. die Verlängerung von Zuggliedern bei Brücken.
. Mit dem E-Modul lassen sich bei bekannter Belastung umgekehrt Dehnungen berechnen, z.B. die Verlängerung von Zuggliedern bei Brücken.

 der selben Brauerei..
der selben Brauerei..